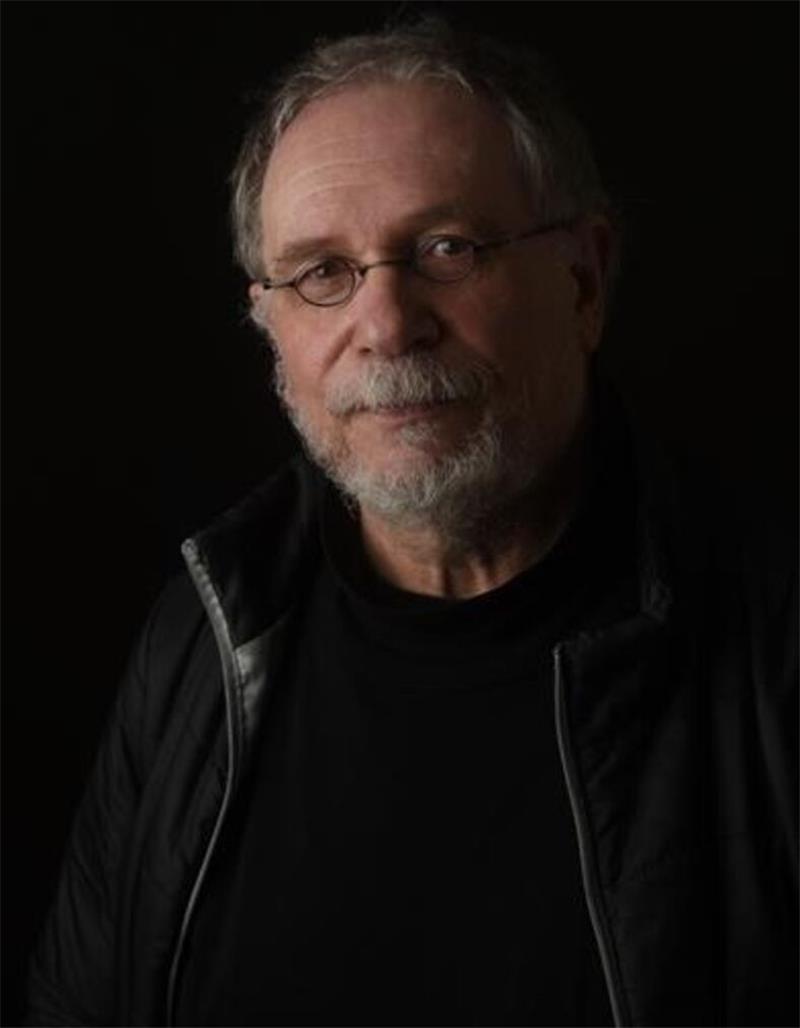Von der Mechanik der Macht
Zum Ende des Monats muss Wolfgang Gebing sein Büro räumen, die Devise: Das Leben geht weiter
KLEVE. Ein bisschen neidisch ist man schon. Der Mann hat ab Montag zwei Wochen Urlaub und fährt... nach Wien. „Sahn‘s nadisch?“ „A bisserl scho.“ Dann kommt der nicht so schöne Teil. Nach der Rückkehr wird der Mann sein Büro räumen: Amtsübergabe. „Such is life“, sagt Wolfgang Gebing, künftiger Ex-Bürgermeister der Stadt Kleve.
NN: Wie geht’s Ihnen mittlerweile?
Wolfgang Gebing: Mit dem Abstand hab ich es verdaut. Ich bin aber trotzdem traurig. Die Kollegen hier sind mir ans Herz gewachsen.
Sie sind ab der kommenden Woche in Urlaub.
Gebing: Ja. Und dann bin ich für die letzte Woche meiner Amtszeit wieder da.
Wie ist das, wenn Sie jetzt hier durchs Haus gehen? Haben Sie das Gefühl, die Leute sind anders drauf?
Gebing: Eigentlich nicht. Einige gucken traurig, andere wissen nicht so richtig, wie sie sich verhalten sollen. Spricht man den an? Spricht man den nicht an? Ich kann das nachvollziehen. Andererseits: Man hat mir eine Aufgabe entzogen … ich bin traurig, aber – so platt das klingen mag: Das Leben geht weiter.
Als Anwalt in der Kanzlei?
Gebing: Mit hoher Wahrscheinlichkeit ja.
Gibt es einen Plan B?
Gebing: In die Kanzlei zurückzugehen – das ist der Plan B. Sagen wir es anders: Nach dem Bürgermeister ist die Kanzlei aus meiner Sicht der Plan A.
Wenn daraus nichts werden sollte – wie sieht dann der Plan B aus?
Gebing: Der aus meiner Sicht schwer vorstellbare Plan B – ich bin ja nun einundsechzigeinhalb – könnte also die Pension sein.
Macht keinen Spaß, oder?
Gebing: Ich kann mir das in der Tat nur schwer vorstellen. Was ich allerdings sowohl im Rahmen von Plan A als auch von Plan B machen werde, ist: Wieder ein bisschen aktiver werden in den Bereichen, in denen ich auch beruflich Spaß hatte. Das hat dann viel mit kulturellen Dingen zu tun. Ich bin ja Vorsitzender des Freundeskreises der Singgemeinde.
Stimmlage?
Gebing: Zum großen Glück für die Menschheit singe ich nicht. Ich habe mich aber um Dinge wie Sponsorengelder gekümmert – seit 30 Jahren schon. Das möchte ich auch weiterhin machen. Und dann gibt es noch das Haus Koekkoek, wo ich kraft Amtes tätig war. Das würde ich sehr gern fortführen und auch Tätigkeit im Bereich des Museums Kurhaus.
Mich interessiert die Frage nach der Mechanik der Macht. Bürgermeister ist ja kein Lehrberuf. Was war das Erste, das Wolfgang Gebing als Bürgermeister lernen musste?
Gebing: Wir sprechen ja über zwei Ebenen. Als Bürgermeister ist man ja im klassischen Sinn Politiker und hat also mit dem Rat zu tun. Diese Mechanismen kannte ich. Ich war ja vorher Fraktionsvorsitzender. Als Bürgermeister bekommt man dann viel mehr Aufmerksamkeit. Die Leute konzentrieren sich auf einen; üben manchmal berechtigte und manchmal unberechtigte Kritik. In diesem Amt steht man deutlich mehr in der Öffentlichkeit. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied zum Amt des Fraktionsvorsitzenden. Das ist etwas, an das man sich erst gewöhnen muss. Man ist plötzlich Chef einer Verwaltung. In Kleve sprechen wir da von roundabout 500 Menschen. Da tauchen Dinge auf, die einem vorher als Politiker und einfacher Bürger nicht aufgefallen sind. Da gibt es Kollegen, die abseits der öffentlichen Wahrnehmung täglich wichtige Aufgaben ausführen. Da ist Unterstützung wichtig, denn: Wo viele Entscheidungen getroffen werden, können auch Fehler passieren. Wenn es dann zu Beschwerden kommt, laufen die mitunter beim Bürgermeister auf. Da muss der Bürgermeister und Verwaltungs-Chef einen Ausgleich finden. Ich bin ja von Haus aus Arbeitsrechtler. Dass in Unternehmen oder Verwaltungen Konflikte auftreten, war mir bewusst, aber als Anwalt kommt man ja in der Regel von außen dazu und ist dann auf einer Seite tätig. Für einen Verwaltungs-Chef sieht die Sache anders aus. Man ist verantwortlich für die Kollegen und sollte in der Lage sein, Konflikte zwischen ihnen zu lösen, bevor sie eskalieren.
Wann dachten sie zum ersten Mal: Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Gebing: Beginnen wir mit dem Positiven: Ich war überrascht – und bin es noch immer – wie gut ein Büro des Bürgermeisters organisiert ist. Dieses unmittelbare Umfeld trägt erheblich dazu bei, dass man den Job überhaupt erledigen kann. Wir reden da von hoch motivierten Mitarbeitern, die nicht selten über 40 Stunden arbeiten und eigentlich immer für einen da sind. Das hat mich sehr positiv überrascht. Was mich dann – auch im gesamtem Haus – ein bisschen negativ überrascht hat, war, dass es tatsächlich Konflikte gibt, die dann auch teilweise mit Hingabe ausgetragen werden. Einige dieser Konflikte sind sicherlich sachlich bedingt, aber oft wechselt ein sachlicher Konflikt relativ schnell auf die menschliche Ebene. Eine fachliche Frage, die sich so oder anders entscheiden lässt, kann man ja ausdiskutieren, aber häufig passiert es dann, dass kein Dialog stattfindet. Da schicken sich Kollegen, die sich in fußläufiger Reichweite von ein paar Metern zueinander befinden, plötzlich Emails und in diesen Emailprozessen eskaliert dann plötzlich ein solcher Konflikt und die Angelegenheit wechselt von der sachlichen auf die persönliche Ebene. Das hat mich überrascht und ich habe immer versucht, das aufzufangen – habe dann gesagt: „Sprecht doch erst mal miteinander. Geht zum Kollegen und versucht, das Problem zu lösen.“ Die „modernen“ Medien haben also zu anderen Umgangsformen geführt.
Irgendwann kommt man also als Bürgermeister hier hin – hat ein eigenes Büro, einen Mitarbeiterstab … Ich denke, das muss doch etwas mit einem machen...
Gebing: Ja. Das macht etwas mit einem.
Setzt da irgendwann die Tendenz ein, das Amt mit der Person gleichzusetzen?
Gebing: Ich fürchte: auf Dauer ja. Nicht nach fünf Jahren. Es gibt da sogar einen Fachbegriff, der da lautet: Cäsarismus. Je länger man in dem Amt ist, umso mehr meint man, dass die Entscheidungen, die man trifft, alle richtig sein müssen, weil sie ja Teil des Amtes sind. Da setzt dann schlimmstenfalls die nötige Selbstreflexion aus. Mich hat es ja auf demokratische Weise bereits nach fünf Jahren erwischt, aber ich glaube schon, dass es gut und wichtig ist, bei bestimmten Ämtern eine zeitliche Schranke einzubauen. Ja, das Amt macht also etwas mit einem und ich denke, dass eine Zeitschranke sinnvoll wäre. Ich bin der Ansicht, dass die Innovation und auch die Leistungsfähigkeit nach zwei Amtszeiten irgendwo enden, weil sich Dinge zur Routine verfestigen. Frischer Wind ist da in der Regel hilfreich.
Wie wichtig ist Kritik?
Gebing: Extrem wichtig, weil Impulse von außen immer notwendig sind. Ich habe immer gesagt: „Ich bin nicht hierher gekommen, um das Evangelium zu verkünden.“ Ich habe eine Meinung, einen Wunsch, einen Willen, aber all das ist nicht unabänderlich. Sachliche Kritik ist immer erwünscht. Das brauche ich, um meine Position zu reflektieren. Von der Möglichkeit zur Kritik haben Kollegen auch rege Gebrauch gemacht. Es wird allerdings in Gesprächsrunden häufig nicht offen Kritik geübt. Ich habe dann auch gesagt: „Kein Problem, wenn jemand in einer Diskussion offen Kritik übt.“
Eigentlich ein spannender Gedanke, das Kritik „geübt“ wird.
Gebing: Bei Kritik kommt es natürlich immer auch auf den Ton an. Ich habe den Kollegen aber auch gesagt: „Wenn jemand nicht vor versammelter Mannschaft Kritik üben möchte – meine Bürotür steht offen. Kommt einfach rein.“ Einige haben auch von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und auf Aspekte hingewiesen, die ich – besonders am Anfang – nicht auf dem Schirm hatte. Der Bürgermeister ist Kopf der Verwaltung und eigentlich derjenige, der alles entscheiden kann und muss – eingeschränkt natürlich durch den Rat, der im eigentlichen Sinn Souverän im Sinne der Kommunalverfassung ist.
Ich habe häufig das Gefühl, dass in der Politik eine große Angst davor besteht, einen Irrtum einzugestehen.
Gebing: Das ist richtig. Diese Angst existiert.
Und eben diese Angst zerstört unglaublich viel innovative Kreativität.
Gebing: Das glaube ich auch. Fortschritt entsteht ja durch Trial and Error. Anders gesagt: Fehler sind der Weg zur wissenschaftlichen Erkenntnis. Man muss natürlich in der Lage sein zu sagen: „Da habe ich mich geirrt.“ Ein falsche Entscheidung sollte allerdings nicht das Ergebnis mangelnder Vorbereitung sein. Es muss darum gehen, einen Sachverhalt gründlich zu erfassen, bevor man über ihn entscheidet. Man sollte nicht auf der Basis unzureichender Faktenkenntnis Entscheidungen treffen. Es gibt aber eben auch die Erkenntnis: Was man für richtig erachtet hat, ist in der Praxis nicht umsetzbar. Dann ist natürlich Korrektur angesagt. Und dazu kann, muss und sollte man stehen.
Aber es wird selten so gemacht.
Gebing: Da stimme ich Ihnen zu. Die Leute meinen, sie würden das Gesicht verlieren.
Aber eigentlich kann man doch, wenn man es richtig erklärt, an Respekt gewinnen.
Gebing: Das ist doch genau gesehen ein Zeichen von Stärke. Natürlich sollte so etwas dann nicht jeden Tag passieren. Aber: Wenn man einen falschen Weg gegangen ist, muss man zu einer Korrektur in der Lage sein.
Wie wichtig ist ein guter Abgang?
Gebing: Ich denke, das ist extrem wichtig. Man muss sich vernünftig von den Leuten verabschieden, auch wenn das manchmal schwer fällt. Es gibt Menschen, die mich nicht mögen – die mich nicht gewählt haben … dafür mag es Gründe geben … aber ich muss doch jetzt nicht gekränkt sein nach dem Motto: Wieso habt ihr mich nicht gewählt? Es ist wie es ist. Ich muss das zur Kenntnis nehmen. Aus einem Gekränktsein heraus etwas zu sagen, ist keine gute Idee, denn man sagt dann schnell Dinge, die man eigentlich nicht sagen wollte und auch nicht sollte und die dann bei Licht betrachtet auch nicht richtig sind. Ich denke, dass eine gewisse Demut jedem gut zu Gesicht steht. Die Devise: Erst mal sacken lassen. Ich habe mich in den letzten Tagen innerlich auf die Dinge konzentriert, die mir nicht gepasst haben. Das erleichtert das Abschiednehmen. Man sollte nicht mit dem Gedanken an die schönen Dinge beginnen, die man jetzt nicht mehr machen kann.
Was gehört zu den Dingen, bei denen sie erleichtert sind, sie nicht mehr machen zu müssen?
Gebing: Da gab es Ausschusssitzungen, die kein Ende nahmen, obwohl eigentlich längst alles geklärt war. Da denkst du nach einer halben Stunde: Wir sind mit allem durch. Und dann stellst du fest: Es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Das sind Dinge, die man nicht vermisst.
Und was werden Sie vermissen?
Gebing: Die Freundlichkeit hier im Rathaus – den Teamgeist. Das Gemeinschaftsgefühl und die konstruktive Zusammenarbeit werden mir sicherlich fehlen. Und zu dem, was fehlen wird, gehört auch der Kontakt zu den Bürgern. Es gehört aber auch die Möglichkeit dazu, eine Stadt zu repräsentieren. Ich denke auch an die Herzlichkeit, mit der ich in den Niederlanden aufgenommen wurde.
Wie viel Persönliches steckt im Bürgermeisterbüro?
Gebing: Nicht wirklich viel.
Anders gefragt: Was nimmt Wolfgang Gebing mit, wenn es vorbei ist?
Gebing: Meine Talismänner habe ich schon mitgeschleppt. Und die Kunst hier gehört nicht mir.
Macht man sich Gedanken über den letzten Tag? Muss man eine Rede reden?
Gebing: Die Gelegenheit gibt es eigentlich nicht. Ich werd‘ keine Reden reden.
Gehen Sie einmal durchs Haus, um sich von jedem zu verabschieden?
Gebing: Das wird nicht klappen. Das würde locker zwei Tage dauern. Ich habe das währemd meiner Amtszeit immer zu Weihnachten gemacht. Aber an einem Tag ist das nicht zu machen, denn da gibt es ja auch noch die Außenstelle.
Schreibt man eine Email an alle?
Gebing: Ja. Das ist hier im Haus allgemein üblich. Im Rat habe ich gestern ein paar Sachen gesagt. Das hatte ich eigentlich nicht geplant … aber die Kollegen haben [schluckt] dann ein paar nette Worte gesagt. Da ist man dann doch irgendwie angefasst. Das tropft nicht einfach ab.
Wolfgang Gebings Amtszeit endet bald. NN-Foto: Rüdiger Dehnen