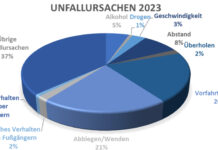KLEVE. Musik-Erleben beginnt manchmal vor dem Konzert. Zwei Wochen lang unterrichtete Georg Friedrich Schenck, Klavier-Professor an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf, im Rahmen des internationalen Studentenmusikfestivals einen Meisterkurs. Unterricht als Exkursion ins Wunderbare.
Da kommt einer und erklärt die Welt mit anderen Mitteln. Da kommt einer und macht Musikunterricht zu einer Welterlebnisstunde. Nicht „laut hier“, „etwas leiser dort“, sondern Modulation des Seelenraumes. Nicht mehr. Nicht weniger. Die Methode Schenck.

Vielleicht muss man erwähnen, dass Partituren eine Art Handlungsanweisung mit beschränkter Haftung sind. Töne sind vorgegeben – Geschwindigkeiten, Tempi vielleicht. Und dann? Dann kommt Schenck und lehrt seine Schüler, aus einem Instrument mehrere zu machen. Es geht um den Klang – um Zustände und Zuständigkeiten. Da sitzt einer, spielt mehrmals eine Tonfolge und alles ändert sich: Farbe, Raum, Intensität, Instrument. Eigentlich wollte man eine Stunde Musikunterricht erleben – sehenhörenfühlen, was einer zu diesem oder jenem Stück zu sagen hat. Und dann: Pustekuchen. Ein Pustekuchen der besonderen Art: Schenck bläst in die Glut der Töne und entfacht ein Feuer – kein Strohfeuer sondern eines, an dessen Ende man Töne nie wieder hören kann wie man sie vorher gehört hat. Worte erreichen eine natürliche Endlichkeit, wenn man Schencks Botschaft beschreiben möchte. Botschaft – in jeder Hochschule müssten sie eine Botschaft einrichten und Visa erteilen, damit man ins Land der Schenckschen Klänge zu reisen lernt.
Wo fängt man an? Es soll Menschen geben, die ein Klavier für neutral halten. Zwei Pianisten – ein Klavier. Unterschiede? Der eine spielt lauter, der andere leiser. Schenck ist einer, der viel darüber nachgedacht, was die großen Pianisten voneinander unterscheidet. Er kann Unerklärliches beschreiben. Was ist das Besondere an Horowitz, Gould, Rubinstein?
Schenck ist in einen Teil der Musik gereist, über den viele nicht nachdenken. Das Gute an Schenck: Er ist nicht abgereist und dort geblieben. Er ist zurückgekehrt und verfasst Reiseberichte für seine Studenten. Wer bei ihm studiert, lernt einen Ermöglicher kennen. Klavierspielen können viele, aber Musik ist mehr als die Abfolge richtig gespielter Noten. Es geht um den Ton der Töne. Was nützt die Vorstellung, wenn sie nicht in die Tasten findet? Warum klingt dasselbe Stück beim einen atemberaubend und beim anderen bestenfalls schön?
Haltung hat zwei Aspekte. Sie findet im Kopf statt und am Klavier. Schenck sitzt tief: Der Klavierhocker zwingt den Pianisten in ungeahnte Tiefen. Nein, er zwingt nicht. Mit der Haltung beginnt Ermöglichung. „Wenn sie so sitzen, ist das wie eine Klanglupe“, sagt Schenck. Flügel und Klang werden größer. Alles gerät unters Brennglas. „Das Gute wird besser – das Schlechte schlimmer.“ „Passen Sie auf“, sagt er und lässt seine Studentin dasselbe Stück auf drei verschiedenen Hockern spielen. Der eine: Normal. Der andere: Sehr tief. Der Dritte: Ein Mittelding. „Hören sie die Unterschiede?“
Wenn Schenck unterrichtet, wird der Raum zum Tanzsaal. Schenck sitzt nicht auf einem Stuhl und doziert. Er ist im Raum unterwegs und modelliert. Wie ein Shaolin bearbeitet er die Klänge – erklärt, dass die einen wie Eiszapfen sind und darunter andere schmelzen. Es geht um Interpretationstechnik. Auf der einen Seite die Notentechnik – auf der anderen die Klangvielfalt. Dazwischen: Das Klangbild. „Jaja“, möchte man sagen, „reden lässt sich viel“, aber dann setzt sich einer an den Flügel, spielt und erzählt etwas von der Räumlichkeit, erzählt von Tönen, die im anderen Raum klingen und anderen, die im Vordergrund leben und spielt und wie ein Wunder stellen sich Töne hinterm Vorhang auf und andere davor.
Längst hat man begriffen, dass Schenck den Klangraum beherrscht und darüber nachgedacht hat, was einen Ton besonders macht. „Natürlich kann man es auch so spielen“, sagt er und spielt ein Stück Beethoven, „natürlich geht es auch so, aber merken Sie, dass es ranzig klingt?“ Dann addiert er Schenck und entwirft Beethoven aus verschiedenen Perspektiven.
Die Anweisungen an seine Studentin: Nicht aus dem handelsüblichen Musikausdruckswerkzeugkasten. Schenck spricht von Wasser, Eis, Tiger – von Druck und Gegendruck „links Feuer, rechts Wasser“, das Klavier wird zum Flugsimulator. Die Töne erkunden den Raum, schwirren umher und tanzen durchs offene Fenster. Schenck spricht von den zwei Pianistentypen – von den Kühlen und den Glühenden, spricht davon, dass es für beides eine Technik gibt und davon, dass seine Studenten nicht nur spielen sollen sondern kennen. Hören ist Spielen. Wer die Unterschiede hört zwischen einem Gould und einem Rubinstein, muss wissen, wodurch sie zustande kommen. Schenck spricht vom Diderot’schen Paradox: Je perfekter ein Schauspieler spielt und etwas anderes verkörpert als das, was er ist, umso mehr erweckt er den Eindruck der ungestellten Natur. Das „als ob“ des Spiels wird zur Realität. (Lexikon der Filmbegriffe: Das Paradox des Schauspielers.)
Alles, was Schenck sagt, wird kurz darauf zu Klang. „Man muss die Technik kennen“, sagt Schenck. Wer die Leute mitnehmen will in die Töne, der braucht Vokabeln des pianistischen Handelns.
Die Magie der Musik entsteht durch Kenntnis. Dass jemand, der zu Schenck kommt, seinen Notentext beherrscht, darf vorausgesetzt werden. Aber die Kenntnis der Noten ist bestenfalls eine Grundvoraussetzung. Schenck erklärt die Aggregatszustände der Klanglichkeit und lässt seine Studenten in Schichten vordringen, deren Existenz sie vorher nicht einmal ahnten.
Schenck ist einer der Lehrer, die man sich immer gewünscht hat. Er ist der Reiseführer für das magische letzte Zehntel, in dem sich Tonfolgen zum Wunderbaren entwickeln. „Rechts Eis, links Feuer“, steuert er die Studentin, setzt sich an den Flügel und probiert einem Chopin verschiedene Frisuren an. „Hören Sie mal.“ Der Chopin, wie ihn jeder spielt („Irgendwie langweilig.“), der Chopin, der den Raum verlässt und zurückfindet („Das könnte was werden.“), der Chopin, der sich zurücknimmt („Das allein reicht nicht.“), der Chopin, der sich aufbaut („So vielleicht?“), Chopin gesungen, Chopin gesprochen. Die Finger werden zur Klaue oder schmiegen sich um die Tasten. „Nehmen Sie die Knie mehr auseinander“, dirigiert Schenk seine Studentin. Und tatsächlich: Der Klang ändert Farbe und Richtung. Man wird zum kleinen Staunenden im Angesicht einer Kathedrale.
Der da erklärt und erkundet, ist nie ein Besserwisser. Man spürt, dass es um synchrones Erleben geht, dass da einer ist, dem es ums Mitnehmen geht. Wenn man Komponist wäre, möchte man Schenk zum Adjudanten machen. Er würde es richten.
Wann, denkt man am Ende, wann erlebt man schon Großes im Leben? Wann kommt einer und öffnet Augen und Ohren, schmiert die Seele neu und justiert die Sicht auf die Welt? Die Antwort: Jetzt und hier. Und dann siehthörtfühlt man das pianistische Gesamtkunstwerk Schenck und merkt, dass Musik niemals wieder das sein wird, was sie vor einer Stunde war. Erkenntnis ist irreversibel. Musikhören nach Schenk ist wie der Luftraum nach dem ersten Flug der Brüder Wright. Niemand kann mehr behauptem, dass es nicht geht.
Die Töne vor Schenck waren andere als die nach ihm. Schenck lässt ahnen, dass Töne mehr sind als Zeitvertreib. Dass sie ein Appell an das Gewissen der Musiker sind – an die Haltung. Und: An die Kenntnis. Dass es keinen Einlass gibt, ohne dass man sich einlässt. Dass es einen Weg in die Klänge gibt. Man muss sich stellen. Wer nichts lebt kann nichts erleben und umgekehrt.
Fazit: Die großen Momente im Leben sind Momente der Erkenntnis und der Transformation. Nein, Schencks Methode ist nicht in einer Stunde greifbar, nicht in 200 Zeilen. Aber immerhin: Jetzt existiert eine Ahnung. HF